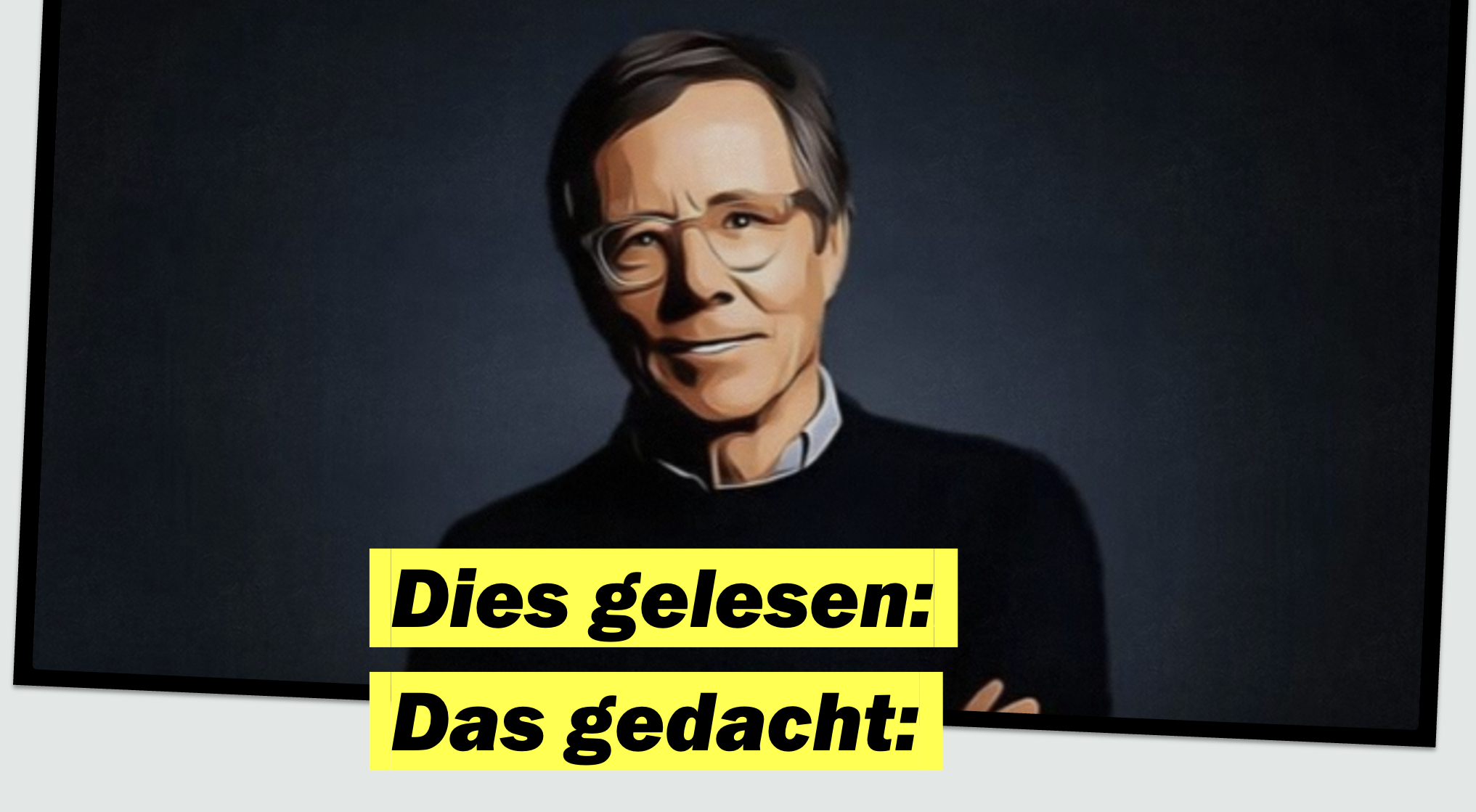Menstruationsurlaub
Inakzeptabel ist, wenn die Gemeinwesen bei den privaten Unternehmen hohe Steuern und Abgaben einfordern und anschliessend diese Einnahmen dazu verwenden, um diese privaten Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt Schachmatt zu setzen.
Dies gelesen: «Die Stadt Zürich testet den Menstruationsurlaub.» (Quelle: www.watson.ch, 1.12.2022)
Das gedacht: Das Parlament der Stadt Zürich hat einen Vorstoss der Grünen überwiesen, der die Einführung eines Menstruationsurlaubs verlangt. Vorerst als Pilotprojekt. Künftig können Frauen, die starke Menstruationsbeschwerden haben, bis zu fünf Tage Urlaub im Monat beanspruchen. Nun bin ich als alter weisser Mann definitiv kein Spezialist für Menstruationsbeschwerden. Und ich weiss auch nicht, ob wie von einer Kommentatorin im Tages-Anzeiger behauptet, Frauen dank des Östrogens nach dem Zyklus wirklich vor Energie strotzen und damit den Urlaub mehr als kompensieren können. Was ich als KMU-Unternehmer aber sehr genau beurteilen kann, sind die fatalen Konsequenzen der mit unseren Steuergeldern finanzierten Grosszügigkeit staatlicher Institutionen für den Arbeitsmarkt.
In der Bundesverwaltung beträgt das Durchschnittseinkommen 125’000 Franken. Dies ist ein Drittel mehr als das Durchschnittseinkommen in der Privatwirtschaft. Dazu kommen weitere Privilegien wie automatische Lohnerhöhungen, grosszügige Pensionskassenregelungen und ein besserer Kündigungsschutz. Ein Ortszuschlag gleicht die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten am jeweiligen Wohn- bzw. Arbeitsort aus. Weiter gibt es Funktionszulagen, Arbeitsmarktzulagen und Sonderzulagen. Mehr